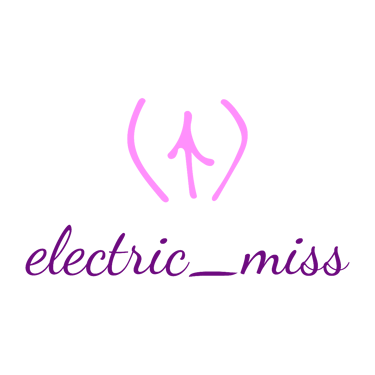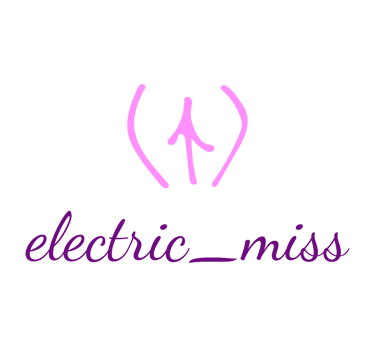Wie ist mein erstes Magazin entstanden?
Und warum es eines der intensivsten Projekte meines Lebens war...
7/20/202518 min lesen
Und warum war es eines der intensivsten Projekte meines Lebens...
Bevor ich die erste Ausgabe meines Magazins in die Hand nahm, bevor ich auch nur eine einzige Seite auf meinem Drucker zu Hause ausgedruckt hatte, hatte ich nur eine vage Idee im Kopf. Ich wusste nur eines: Ich wollte etwas Physisches, Greifbares schaffen. Etwas, das mehr sein würde als nur eine weitere Galerie im Internet. Etwas, das den Menschen lange in Erinnerung bleiben würde. So entstand mein erstes eigenes Magazin: 92 Seiten, 150 Fotos, Emotionen auf Papier gebannt. Es sollte sinnlich, authentisch und mutig sein, genau wie ich. Aber bevor es in die Hände meiner Leser gelangen konnte, habe ich einen Weg zurückgelegt, den ich nicht erwartet hatte und von dem ich Ihnen heute erzählen möchte. Dies wird kein Text über meinen kleinen Erfolg sein. Es wird eine Geschichte über Zweifel, schwierige Entscheidungen, Momente des Zweifels und der Begeisterung sein. Und darüber, dass man sich manchmal mit Dingen auseinandersetzen muss, von denen man zuvor keine Ahnung hatte, um sie dann mit Stolz betrachten zu können. Ich lade Sie ein, einen Blick hinter die Kulissen meines Magazins zu werfen. Vor Ihnen liegen die Kapitel dieser Geschichte... wahrhaftig und ehrlich.
Wie entstand mein erstes Magazin?


Wird das überhaupt jemanden interessieren?
Damit fing alles an, und damit begannen auch meine größten Zweifel. Ich wollte etwas Eigenes schaffen, etwas, das wirklich ein Teil von mir ist, aber von Anfang an begleitete mich eine Frage, die ich nicht loswerden konnte. Was, wenn niemand daran interessiert ist? Was, wenn mein Magazin nur ein weiterer Versuch ist, der ohne Echo verhallt? Was, wenn es etwas ist, das nur ich für wichtig halte, während es für andere nur eine papierene Marotte ist?
Einerseits glaubte ich, dass in einer Welt, in der sich alles um schnelle Inhalte dreht, immer noch jemand auf der Suche nach etwas Persönlicherem ist. Dass es Menschen gibt, die das Gefühl von Papier spüren, gedruckte Fotos betrachten wollen, die sie nicht mit dem Finger auf dem Bildschirm verschieben können. Dass es Menschen gibt, die in die Geschichte eintauchen, die ich ihnen erzählen wollte. Andererseits hatte ich Angst, dass das nur meine Vorstellung war. Dass die Welt kein weiteres Magazin braucht. Dass es niemanden interessiert, was ich zu sagen und zu zeigen habe.
Ich fragte mich, ob mein Mut nicht lächerlich sein würde. Ob ich mit all dem nicht allein dastehen würde. Ob ich nicht Geld, Zeit und Herzblut für etwas verschwenden würde, das niemand braucht.
Aber dann kam mir ein anderer Gedanke: Was, wenn es klappt? Was, wenn es gerade deshalb, weil es persönlich und ehrlich ist, Menschen gibt, die sich davon angesprochen fühlen? Ich durfte mich nicht von der Angst lähmen lassen, die ich nur zu gut kannte. Das war der erste Moment, in dem ich mich entscheiden musste, dass das Risiko nicht meine Bremse, sondern meine Triebkraft sein würde.
Dieses Magazin sollte für andere sein, aber es begann bei mir. Damit, mich meiner eigenen Stimme zu stellen, die immer wieder sagte: „Was, wenn es nicht klappt?“ Und mit der Antwort, die später kam: „Was, wenn es klappt?
Wo endet Sinnlichkeit und wo beginnt Pornografie?
Diese Frage kam mir bei jeder Auswahl eines Fotos in den Sinn. Und es gab keine einfache Antwort darauf. Ich wollte, dass mein Magazin mutig, authentisch und körperbetont ist, aber nicht vulgär. Dass es auf diesem schmalen Grat balanciert, der den weiblichen Körper nicht auf einen billigen Effekt reduziert, ihn aber auch nicht unter Schichten von Zensur und vorgetäuschter Unschuld versteckt. Ich musste diese Grenze festlegen, da Druckereien keine Pornografie drucken wollen.
Ich habe mir jedes Foto mehrmals angesehen und mir jedes Mal die gleichen Fragen gestellt. Ist es noch sinnlich? Ist es mutig im positiven Sinne? Zeige ich mich selbst oder nur meinen Körper? Möchte ich, dass jemand es mit Begierde oder mit Neugier betrachtet? Oder vielleicht mit Bewunderung? Wird die Druckerei es nicht ablehnen?
Ich wollte auch kein sicheres, emotionsloses Magazin schaffen. Denn so bin ich nicht. Ich wollte ein echtes Bild des weiblichen Körpers, meines Körpers, so gezeigt, wie ich ihn sehe.
Diese Grenze ist nicht fest. Manchmal ändert sie sich von Tag zu Tag. Manchmal hängt sie davon ab, wer hinschaut. Und manchmal davon, ob ich es wage, mich selbst ohne den Filter der Scham anzuschauen. Dieses Magazin ist für mich genau das geworden ... eine Möglichkeit, mich mit meinen eigenen Mustern und dem, was ich mir selbst über Weiblichkeit, Sexualität und Nacktheit eingeredet habe, auseinanderzusetzen.
Ich habe diese Frage nicht ein für alle Mal beantwortet. Und ich glaube, ich will das auch gar nicht. Denn gerade in diesem Gleichgewicht, in diesem Spiel zwischen dem Zeigen von Nacktheit und dem Nicht-Zeigen von Pornografie, liegt die ganze Kraft dieses Projekts.


Druckereien, die keine Nacktfotos drucken wollen
Ich dachte, dass das heutzutage eine reine Formalität wäre. Schließlich wird so viel über künstlerische Freiheit gesprochen, über den Akt als Kunstform, über den Körper als Ausdrucksmittel. Ich dachte... ich mache es, schicke die Dateien, bezahle und sie drucken es. Es ist doch legal, meine Fotos, meine Vision.
Die Realität holte mich schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich begann, die Nutzungsbedingungen der Plattformen für Druck und Veröffentlichung auf Abruf zu lesen: Peecho, Blurb, BookBaby. Jede von ihnen hatte ihre eigenen Regeln. Und fast alle machten mehr oder weniger deutlich: „Ja, aber nicht zu viel”, „Ja, aber nicht zu gewagt”, „Ja, aber ohne sichtbare Genitalien”... Ich fühlte mich ein bisschen wie in einem Spiel mit unsichtbaren Regeln, die man nicht genau kennen kann, bis man über eine davon stolpert.
Ich bereitete die Dateien vor, in der Annahme, dass sowieso etwas geändert werden müsste. Ich fragte mich, ob einige Fotos blockiert werden würden, ob das Projekt von einer Maschine abgelehnt werden würde oder vielleicht durch die Entscheidung eines Menschen, der einfach der Meinung war, dass „es zu viel“ sei.
Das war der Moment, in dem ich begriff, dass die Verlagswelt, auch die Online-Verlagswelt, ihre ungeschriebenen Regeln hat. Und dass die künstlerische Freiheit oft dort endet, wo die Regeln der Plattformen beginnen.
Aber ich wollte nicht aufgeben. Anstatt nach Abkürzungen zu suchen, begann ich nach Lösungen zu suchen. Ich testete Plattformen, stellte Fragen, holte Rat ein. Ich wusste, dass ich diese Welt von innen kennenlernen musste, wenn ich wollte, dass dieses Magazin genau so entsteht, wie ich es mir vorstellte.
Anstatt mich entmutigen zu lassen, betrachtete ich es als eine weitere Lektion. Und vielleicht ist dieses Projekt für mich deshalb so wichtig, weil es nicht einfach war, weil es Hartnäckigkeit und Mut erforderte, nicht nur vor der Kamera, sondern auch gegenüber den Nutzungsbedingungen, die manchmal mehr entblößen als das Foto selbst.
Der Kampf mit Rändern, QR-Codes, Formaten und PDFs
Niemand hat mir gesagt, dass eine der größten Herausforderungen weder das Foto noch der Text noch der Mut sein würden... sondern die technischen Details. Es war eine Welt, in der alles wegen einem Millimeter zusammenbrechen konnte. Ränder, Beschnittzugaben, Auflösung, Farbprofile – etwas, das für die meisten Menschen völlig unsichtbar ist, wurde für mich zu einer Quelle endloser Frustration.
Anfangs dachte ich, Canva würde ausreichen. Ich würde Fotos hochladen, sie anordnen, Texte hinzufügen und fertig. Es stellte sich schnell heraus, dass dem nicht so war. Dass der Sicherheitsrand kein optionaler Streifen ist, sondern etwas, das darüber entscheidet, ob der Text am Rand der Seite verschwindet. Dass das, was auf dem Bildschirm schön aussieht, beim Drucken verschoben, gedehnt oder verschmiert werden kann. Dass die PDF-Datei das richtige Format mit den richtigen Markierungen haben muss, sonst wird sie von der Druckerei einfach abgelehnt.
Dann kamen die QR-Codes. Einfach? In der Theorie. In der Praxis musste man einen Platz finden, wo sie hineinpassen, die Komposition nicht stören, gut sichtbar sind, aber die Seite nicht dominieren. Sie mussten lesbar sein, eine ausreichend hohe Auflösung und den richtigen Kontrast haben. Ich habe sie so oft getestet, dass ich nachts davon geträumt habe, bis ich schließlich nur einen auf der zweiten Seite des Magazins eingefügt habe.
In der Zwischenzeit habe ich mehrere Programme ausprobiert: Canva, LibreOffice Draw, Affinity Publisher. Jedes hatte seine Vorzüge und Einschränkungen, jedes erforderte, dass ich neue Dinge lernen musste. Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich korrigiert, exportiert und von vorne angefangen habe. Immer wenn ich dachte, es sei endlich fertig, tauchte etwas auf, das korrigiert werden musste.
Ich habe verstanden, dass das Erstellen eines Magazins nicht nur Kreativität erfordert, sondern auch Geduld und Demut gegenüber Dingen, die wie technische Details erscheinen. Genau diese Details entschieden darüber, ob das Ganze professionell oder wie ein chaotischer Haufen aussehen würde.
Und so weiß ich heute, dass es sich gelohnt hat, sich mit all diesen Details auseinanderzusetzen. Denn genau sie haben dafür gesorgt, dass ich am Ende etwas in den Händen hielt, das genau so aussah, wie ich es mir vorgestellt hatte.




Ein QR-Code, der einfach funktionieren musste
Dieser Code war ein bisschen wie eine Geduldsprobe. Es schien ganz einfach zu sein: generieren, einfügen, ausdrucken, fertig. Aber schnell stellte sich heraus, dass etwas, das für den Empfänger selbstverständlich sein soll, für mich perfekt ausgearbeitet sein muss.
Ich wollte, dass er ästhetisch aussieht. Dass er nicht nur ein gewöhnlicher schwarz-weißer Aufkleber ist, der mit Gewalt aufgeklebt wurde, sondern ein natürlicher Teil des Designs. Dass er zum Stil des Magazins passt, die Fotos nicht beeinträchtigt und nicht ablenkt. Und dass er immer funktioniert, egal ob jemand ihn mit seinem Handy bei Tageslicht oder im Halbdunkel seines Schlafzimmers scannt.
Aber was wichtig ist... ich wollte nicht, dass er auf jeder Seite erscheint, weil ich befürchtete, dass er die gesamte Atmosphäre und Subtilität zerstören würde. Deshalb habe ich beschlossen, ihn nur auf der zweiten Seite des Magazins zu platzieren. Es sollte der einzige Zugang zu meiner geschlossenen Welt sein... ein Ort, den der Leser bemerkt, der aber nicht das gesamte Projekt dominiert.
Ich habe den Code in verschiedenen Versionen vorbereitet, mit Rahmen, ohne Rahmen, auf hellem Hintergrund, auf dunklem Hintergrund, ich habe Größen, Einstellungen und Kontraste getestet. Ich habe Muster auf meinem Drucker zu Hause ausgedruckt und überprüft, ob es funktioniert. Manchmal hat es sofort funktioniert, manchmal nicht... Ich habe manchmal einen halben Abend damit verbracht, ihn um ein paar Millimeter zu verschieben, um sicherzugehen, dass er nach dem Zuschneiden des Papiers nicht verschwindet.
Schließlich kam ich zu dem Schluss, dass ich es nicht dem Zufall überlassen darf, wenn etwas wirklich gut funktionieren soll. Unter dem Code habe ich auch meine E-Mail-Adresse angegeben, für den Fall, dass bei jemandem etwas nicht funktioniert oder ein Problem mit dem Zugriff auftritt. Ich wollte, dass sich jede Person, die mein Magazin in die Hand nimmt, gut aufgehoben fühlt.
Dieser Code war für mich mehr als nur ein Link. Er war wie ein Schlüssel zu einer Welt, die man nirgendwo sonst finden kann. Zu einer Galerie, zu Filmen und Inhalten, die nur denen zugänglich sind, die wirklich zu diesem Stück Papier von mir gegriffen haben.
Wenn ich heute auf die zweite Seite meines Magazins schaue, weiß ich, dass dieses kleine schwarz-weiße Muster eine der größten Herausforderungen und eines der Dinge war, auf die ich am meisten stolz bin. Denn es hat mich etwas gelehrt, was kein Kurs lehrt: Jedes Detail zählt.
Erlaubt mir mein Hosting, solche Inhalte zu veröffentlichen?
Ich dachte, wenn ich für meine Website bezahle, kann ich darauf veröffentlichen, was ich will. Schließlich ist es kein soziales Netzwerk und kein Marktplatz mit einer Menge Einschränkungen. Es ist mein Raum, mein Platz im Internet. Und doch... von Anfang an hatte ich das Gefühl, dass ich das überprüfen sollte. Und das war gut so, denn die Realität hat schnell gezeigt, dass selbst auf der eigenen Website nicht alles so offensichtlich ist.
Ich habe die Nutzungsbedingungen, Inhaltsrichtlinien und Hilfeseiten durchforstet. Ich suchte nach einer Antwort auf eine Frage, die ich mir eigentlich noch nie gestellt hatte: Darf ich auf meiner Website legal Nacktfotos veröffentlichen?
Die Antwort? Es kommt darauf an.
Darauf, wie man „gewagte Inhalte” definiert.
Davon, wie sie die Hosting-Plattform definiert.
Und davon, wie es derjenige beurteilt, der gerade die Website überprüft, wenn etwas Verdacht erregt.
Also begann ich, vorsichtig zu handeln. Ich wollte sichergehen, dass ich keine Regeln verletzte, aber ich wollte mich nicht in Schemata einschränken lassen. Deshalb beschloss ich, auf der Website einen speziellen Bereich zu erstellen, der versteckt und nur für Personen zugänglich ist, die mein Magazin tatsächlich gekauft und den QR-Code gescannt haben. Ohne unnötige Datenschutzrichtlinien, ohne Nutzungsbedingungen, ohne formelle Zugangsberechtigungen. Nur ein Passwort, das nur die Leser meines Magazins kennen.
Das war meine Art, für Privatsphäre zu sorgen und gleichzeitig die Intimität dessen zu bewahren, was ich geschaffen hatte. Denjenigen, die sich tatsächlich für mein Projekt entschieden hatten, etwas Besonderes zu bieten, ohne den Zugang unnötig zu verkomplizieren oder Formalitäten aufzubürden.
Das war eine Lektion, die ich nicht erwartet hatte. Dass man selbst mit einer eigenen Website nicht ganz frei ist. Dass man die Regeln kennen muss, wissen muss, wie man sich in der Online-Welt bewegt, wo Privatsphäre, Recht und Sicherheit genauso wichtig sind wie Ästhetik und Inhalt.
Aber entgegen dem, was man meinen könnte, hat mir das nicht mein Selbstvertrauen genommen. Im Gegenteil, das Bewusstsein, dass ich alles nach meinen eigenen Regeln mache, hat mir Ruhe gegeben. Und das Gefühl, dass ich wirklich die Kontrolle darüber habe.
Will ich mich wirklich unzensiert zeigen?
Diese Frage bezog sich nicht nur auf Fotos. Entgegen dem Anschein ging es nicht darum, ob jemand meinen Körper sehen würde. Es ging um etwas viel Persönlicheres... darum, ob ich bereit bin, mich als Autorin, als Frau, als jemand zu zeigen, der sich nicht hinter der sicheren Distanz des Internets versteckt.
Im Internet passieren viele Dinge nur für einen Moment. Ein Foto wird gescrollt, verschwindet. Beiträge können bearbeitet, gelöscht, versteckt werden. Hier sollte es anders sein. Das Magazin war für mich etwas Unumkehrbares... eine echte, physische Spur, die in die Hände von jemandem gelangen würde.
Und genau dann begannen die wirklichen Zweifel.
Denn es ist etwas anderes, sich auf einem Foto im Internet zu zeigen, als dieses Foto auf Papier zu bannen, es zu unterschreiben und jemandem zu schicken. Es ist etwas anderes, ein paar Worte unter einen Beitrag zu schreiben, als seine Texte in ein gedrucktes Magazin zu bringen und sich bewusst zu sein, dass sie länger bei jemandem bleiben werden.
Irgendwann fühlte ich mich ... nackt. Dabei ging es nicht um den Körper. Es war die Nacktheit der Gefühle, das Offenlegen meiner Geschichte, meiner Worte, meiner Gedanken und dessen, was ich der Welt zeigen möchte. Es war die schwierigste Form der Ehrlichkeit, denn man kann sich nicht davon zurückziehen, man kann sie nicht mit einem Klick korrigieren.
Aber genau darin lag die Stärke dieses Projekts. In der Entscheidung, sich nicht mehr hinter Distanz, hinter einer Pose, hinter dem, was sicher ist, zu verstecken. Der Mut bestand nicht darin, so viel wie möglich zu zeigen, sondern darin, sich nicht zu verstellen.
Ich wollte nicht ein weiteres Produkt sein, ein weiterer Name ohne Geschichte. Ich wollte ich selbst sein. Und ich wusste, dass nur dann dieses Magazin Sinn machen würde.
Machen meine Worte Sinn?
Das war eine ganz andere Frage als die, die sich auf die Fotos oder das Aussehen des Magazins bezogen.
Denn obwohl ich wusste, dass ich vor der Kamera stehen kann, war ich mir nicht sicher, ob ich genauso gut vor den Augen anderer mit Worten stehen kann.
Im Internet ist es einfach, einen Satz zu schreiben, ein Emoticon hinzuzufügen, ein paar Schlagworte einzufügen, die sich gut anklicken lassen. Aber hier... hatte ich einen Raum, den ich mit mehr als nur einer Bildunterschrift füllen konnte. Ich konnte etwas sagen. Aber was? Würden meine Worte Sinn ergeben? Würde sie überhaupt jemand lesen? Würden sie nicht überflüssig sein?
Von Anfang an wusste ich, dass ich nicht gezwungenermaßen schreiben wollte. Ich wollte keine Plattitüden über Weiblichkeit, ich wollte keine überflüssigen Beschreibungen, die nichts mit mir zu tun haben. Ich wollte, dass meine Worte genauso wahr sind wie die Fotos... persönlich, manchmal vielleicht gewöhnlich, aber ehrlich.
Und genau das stellte sich als das Schwierigste heraus. Denn ich schrieb ja nicht für mich selbst über mich. Ich schrieb für jemanden. Für jemanden, der dieses Magazin in die Hand nimmt, ohne mich persönlich zu kennen, ohne meine Geschichten zu kennen. Und vielleicht, wenn ich die richtigen Worte finde, wird er etwas von sich selbst darin sehen.
Es gab einen Moment, in dem ich darüber nachdachte, aufzugeben. Nur kurze Beschreibungen, Daten und Orte zu schreiben. Die Fotos für sich stehen zu lassen, es nicht zu komplizieren. Aber dann erinnerte ich mich daran, warum ich dieses Projekt begonnen hatte. Es sollte meine Geschichte sein. Nicht nur in Bildern, sondern auch in Worten.
Und deshalb stehen unter jedem Foto ein paar Sätze... manchmal eine Erinnerung, manchmal eine Beschreibung des Augenblicks, manchmal etwas zwischen den Zeilen. Nicht immer perfekt. Aber echt.
Ich weiß nicht, ob diese Texte für jemanden wichtig sein werden. Ich weiß, dass sie mir gehören. Und für mich bedeutet das mehr als jedes modische Schlagwort.


Ist das überhaupt legal?
Anfangs klang das etwas absurd. Schließlich habe ich nichts Illegales getan. Die Fotos waren meine, die Inhalte waren meine, das Projekt war mein. Aber je mehr ich mich mit Veröffentlichungen, Nutzungsbedingungen und Richtlinien von Plattformen beschäftigte, desto mehr begann ich mich zu fragen, ob ich mich nicht auf ein Minenfeld begab, das ich zuvor nicht gesehen hatte.
Ich habe mir die Nutzungsbedingungen von Peecho, Blurb und BookBaby angesehen, dann die Websites von Druckereien, Datenschutzrichtlinien und Vertriebsregeln. Und mit jeder weiteren Seite stellte ich fest, dass die Verlagswelt voller Bestimmungen ist, die zwar offensichtlich sind, aber dennoch Unbehagen hervorrufen können. Was ist verboten? Was ist „inakzeptabler Inhalt”? Wo endet „Kunst” und beginnt etwas, das jemand als Verstoß gegen das Gesetz oder die Regeln der Plattform betrachten könnte?
Einerseits wusste ich, dass meine Fotos in der Zeitschrift keine Pornografie sind, nicht gegen Regeln verstoßen und keine Grenzen überschreiten. Andererseits war mir bewusst, dass eine einzige Interpretation, eine einzige Beschwerde, ein einziger Fehler in den Nutzungsbedingungen ausreichen würde, um meine gesamte Publikation verschwinden zu lassen oder meine Website zu sperren.
Ich wollte kein Risiko eingehen. Ich begann, genauer zu lesen. Fragen zu stellen. Zu überprüfen. Zu analysieren. Ich vergewisserte mich, dass alles, was ich tat, mit dem Gesetz, den Regeln der Plattformen und den Datenschutzbestimmungen vereinbar war. Denn ich wollte nicht, dass dieses Projekt scheiterte, nicht weil es nicht gut war, sondern weil ich etwas übersehen hatte.
Diese Phase hat mir etwas Wichtiges beigebracht.
Dass Kunst und Geschäft zwei verschiedene Dinge sind.
Dass man in der heutigen Welt, um ein freier Künstler zu sein, auch ein bewusster Unternehmer sein muss.
Und dass man, wenn man wirklich etwas auf seine eigene Weise machen will, die Spielregeln besser kennen muss als diejenigen, die nur von der Seitenlinie aus kommentieren.
Was, wenn es sich nicht verkauft?
Diese Frage kennt wohl jeder, der jemals etwas Eigenes geschaffen und beschlossen hat, es der Welt zu zeigen. Selbst wenn man sich immer wieder sagt, dass man es für sich selbst tut, taucht irgendwo im Hinterkopf diese Stimme auf: „Was, wenn es niemand kauft? Was, wenn es niemandem gefällt? Was, wenn das alles nur Zeit- und Geldverschwendung war?“
Mir ging es nicht nur um den Verdienst. Nicht darum, eine bestimmte Anzahl von Exemplaren zu verkaufen. Es ging mir eher darum, ob dieses Magazin seine Leser finden würde. Ob jemand danach greifen, es aufschlagen und sich zumindest für einen Moment damit beschäftigen würde. Ob jemand die Emotionen spüren würde, die ich in jedes Foto und jedes Wort gesteckt habe.
Es gab einen Moment, in dem ich dachte: Vielleicht sollte ich es gar nicht erst versuchen. Vielleicht ist es zu riskant. Vielleicht sollte ich dieses Projekt besser in der Schublade verschwinden lassen und nie erfahren, wie es wäre. Denn wenn ich es nicht versuche, muss ich auch keine Angst vor einem Misserfolg haben.
Aber dann stellte ich mir eine andere Frage: Was, wenn es genau deshalb lohnenswert ist? Was, wenn es nicht um das Ergebnis geht, sondern um die Tatsache, dass ich mich getraut habe?
Ich weiß nicht, ob ich jemals aufhören werde, Angst davor zu haben. Aber ich weiß, dass ich nicht möchte, dass die Angst vor mangelnden Verkaufszahlen darüber entscheidet, ob ich überhaupt etwas schaffe. Und dass, selbst wenn dieses Magazin kein Bestseller geworden ist, es für mich etwas viel Wichtigeres ist... ein Beweis dafür, dass ich alles auf etwas setzen kann, an das ich glaube.


Habe ich wirklich die richtigen Fotos ausgewählt?
Das war eine der persönlichsten und schwierigsten Entscheidungen überhaupt. Denn ich hatte Hunderte von Fotos. Jedes davon wurde zu einem bestimmten Anlass, zu einem bestimmten Zeitpunkt und in einer bestimmten Stimmung aufgenommen. Und jedes schien mir in diesem Moment wichtig zu sein.
Aber als es an die Auswahl ging, begann die eigentliche Herausforderung. Wie wählt man diejenigen aus, die wirklich etwas bedeuten? Diejenigen, die nicht nur ein hübsches Bild sind, sondern Emotionen vermitteln? Diejenigen, die zueinander passen und ein zusammenhängendes Ganzes bilden und nicht nur eine zufällige Ansammlung sind?
Es war nicht einfach. Mit jeder weiteren Auswahl stellte ich fest, wie viele Fotos mir nur „im Moment” gefielen, weil sie gerade in Mode waren, weil sie zu den sozialen Medien passten, weil sie sich gut anklicken ließen. Aber waren das Fotos, die ich in meinem Magazin haben wollte? Fotos, die ich an Menschen schicken wollte, die mich repräsentieren sollten?
Ich wählte aus, lehnte ab, kam zurück. Ich konnte stundenlang ein Foto betrachten, meine Meinung fünf Mal ändern, es beiseite legen, um nach zwei Tagen wieder darauf zurückzukommen. Mal ließ ich mich von Emotionen leiten, mal von Ästhetik, mal von der Geschichte, die dahinter stand. Und ich hatte immer das Gefühl, dass es nicht genug war. Dass man immer etwas Besseres hätte auswählen können.
Aber irgendwann musste ich mir sagen: Stopp. Mir klar machen, dass ich nicht nach Perfektion suche, sondern nach Wahrheit. Dass ich keinen Modekatalog oder Werbebroschüre mache, sondern eine Geschichte erzähle. Und dass, wenn mich etwas bewegt, es vielleicht genau deshalb hier sein sollte.
Wenn ich mir heute diese 150 Fotos anschaue, weiß ich, dass das eine der besten Entscheidungen war. Dass sie nicht perfekt sind. Aber sie sind meine. Und sie sind genau so, wie ich sie haben wollte.
Über 120 Stunden Arbeit und Lernen
Wenn man sich das fertige Magazin ansieht, könnte man den Eindruck gewinnen, dass es sich einfach um eine Sammlung von Fotos und Texten handelt, die auf Papier gebannt sind. Aber hinter jeder Seite verbirgt sich etwas, das man nicht sieht: Stunden der Arbeit, Tests, Korrekturen und das Erlernen von Dingen, von denen ich noch vor wenigen Monaten keine Ahnung hatte.
Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich von vorne angefangen habe. Wie oft habe ich das Layout der Seite korrigiert, Fotos um Millimeter verschoben, Texte geändert, weil etwas doch nicht so klang, wie ich es wollte. Jede Korrektur war eine Entscheidung – manchmal eine technische, manchmal eine emotionale.
Aber die größte Herausforderung war wohl, all das von Grund auf zu lernen. Die Arbeit mit Canva, LibreOffice, Affinity, das Verstehen von Druckformaten, die Vorbereitung von PDF-Dateien, Auflösungen, Beschnittzugaben, Layoutregeln. Dazu kam das Lesen von Regeln und Richtlinien, das Einholen von Ratschlägen, die Suche nach Antworten auf Fragen, die ich mir zuvor nie gestellt hatte.
Es gab niemanden, der mir Schritt für Schritt erklärt hätte, wie das geht. Ich hatte keine fertige Anleitung oder einen Leitfaden. Es gab nur mich, das Internet und jede Menge Versuche und Fehler.
Über 120 Arbeitsstunden, verteilt auf Tage und Abende. Zeit, die von Details, technischen Fragen und Entscheidungen verschlungen wurde, die vielleicht unwichtig erschienen, aber letztendlich den gesamten Effekt ausmachten.
Und obwohl es Momente gab, in denen ich alles hinschmeißen wollte, weiß ich eines: Es hat sich gelohnt. Denn diese Zeit hat mich mehr gelehrt als jeder Kurs oder Ratgeber. Sie hat mich Geduld und Beharrlichkeit gelehrt und dass man, wenn man etwas wirklich will, einen Weg findet, es zu erreichen.


Warum war das alles die Mühe wert?
Wenn man das fertige Magazin in den Händen hält, sieht man nur das Ergebnis. Das Cover, die Fotos, die Worte, die sich zu einem Ganzen zusammenfügen. Man sieht nicht die vielen Arbeitsstunden, die Momente des Zweifels, die Momente, in denen ich alles wegwerfen und von vorne anfangen wollte. Man sieht nicht all die schlaflosen Nächte, die offenen Lesezeichen mit Ratgebern, die Testausdrucke und die Fragen, die einem immer wieder durch den Kopf gehen: „Wird das jemandem gefallen? Hat das überhaupt einen Sinn?“
Aber gerade deshalb ist dieses Magazin für mich zu etwas viel Größerem als nur einem Projekt geworden. Es ist der Beweis dafür, dass ich etwas beginnen kann, ohne etwas zu wissen, und es zu Ende bringen kann. Dass ich Dinge lernen kann, die mir zuvor unerreichbar erschienen. Dass die Angst vor dem Scheitern kein Hemmnis sein muss, sondern eine Motivation.
War es das wert?
Ja. Für jede Nachricht, die ich von euch erhalten habe. Für jeden stolzen Blick auf meine eigene Arbeit. Für das Bewusstsein, dass hinter all dem nicht nur ein Foto oder ein Text steht, sondern auch Mut, Hartnäckigkeit und eine echte Geschichte.
Dies ist keine Erfolgsgeschichte mit Happy End. Es ist eine Geschichte über einen Prozess, über das Reifen einer Entscheidung, über das Überwinden der eigenen Grenzen.
Und genau deshalb weiß ich, dass dies erst der Anfang ist.
Ich danke Ihnen, dass Sie so aufmerksam lesen und bis hierher gekommen sind. Das ist für mich schon eine große Ehre, denn der Weg zur Gründung des Magazins war schwierig... Wenn Sie also auf den Punkt am Ende dieses Satzes klicken, erwartet Sie eine Überraschung. Klicken Sie auf diesen Punkt, kehren Sie zurück und lesen Sie weiter.


Zum Schluss…
Ich weiß, dass dieses Magazin nicht billig ist.
Und ich weiß auch, dass in Zeiten, in denen man alles mit einem Klick bekommen kann, eine Papierpublikation wie ein Luxus oder eine unnötige Ausgabe erscheinen mag. Aber wenn Sie diese Geschichte bis zum Ende gelesen haben, bedeutet das, dass Sie mehr suchen als nur eine gewöhnliche Online-Galerie.
Ich möchte Ihnen ganz offen sagen, dass fast die Hälfte des Preises dieses Magazins die tatsächlichen Kosten für die Auftragsproduktion sind: Druck, Bindung, Vorbereitung und Versand. Es handelt sich nicht um eine Massenauflage. Es ist etwas, das speziell für Sie hergestellt wird. Und nicht der gesamte Betrag landet in meiner Tasche.
Ich könnte ein dünnes Magazin mit 20 Seiten und ein paar Fotos machen. Dann wäre es billiger. Aber ich wusste, dass ich es nicht dafür mache. Ich wollte alles darin unterbringen, was mir wichtig ist, deshalb findest du darin 150 Fotos auf 92 Seiten.
Danke, dass du da bist, dass du liest, dass du schaust.